
Secundino HernándezSecundino Hernández

Secundino HernándezSecundino Hernández

Secundino HernándezSecundino Hernández

Secundino HernándezSecundino Hernández

Secundino HernándezSecundino Hernández

Secundino HernándezSecundino Hernández

Secundino HernándezSecundino Hernández

Secundino HernándezSecundino Hernández

Secundino HernándezSecundino Hernández

Secundino HernándezSecundino Hernández

Secundino HernándezSecundino Hernández

Secundino HernándezSecundino Hernández

Secundino HernándezSecundino Hernández

Secundino HernándezSecundino Hernández

Secundino HernándezSecundino Hernández

Secundino HernándezSecundino Hernández
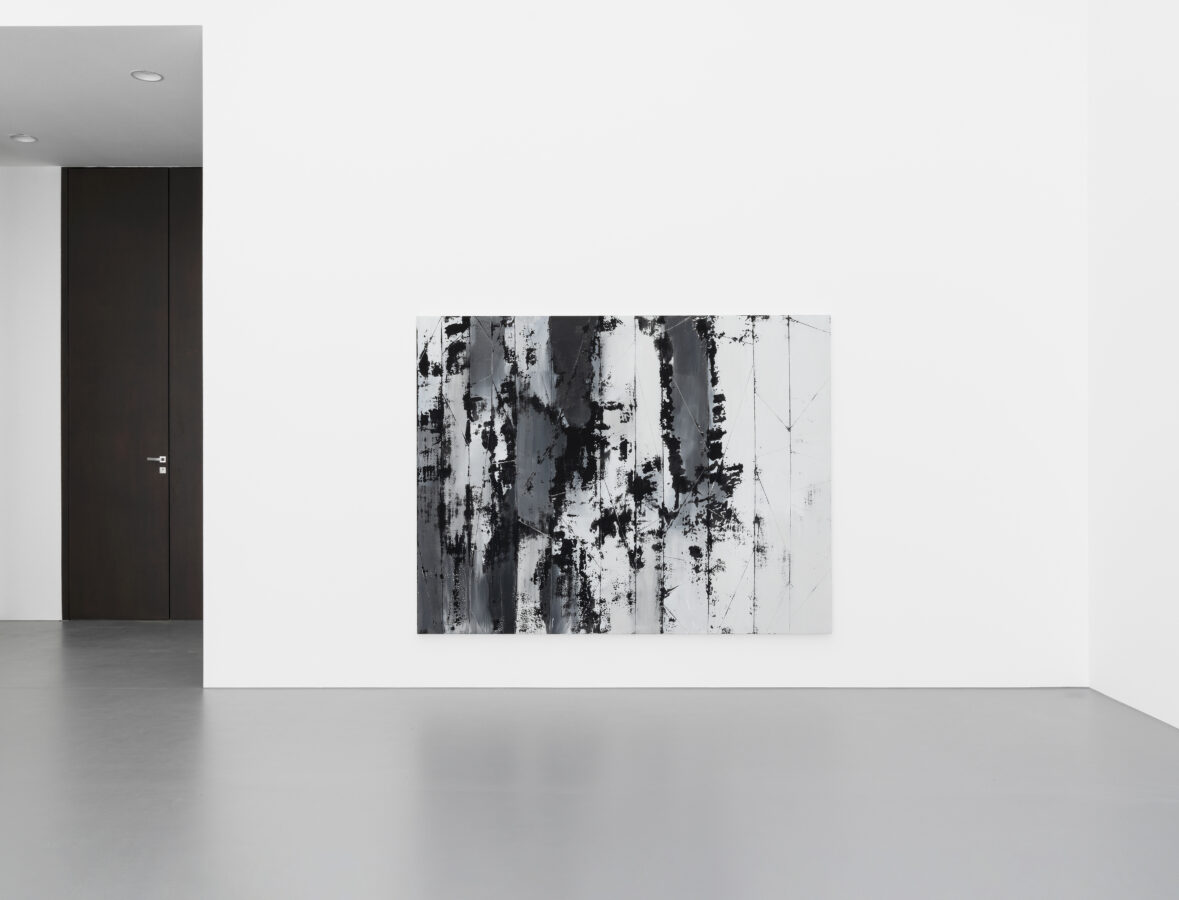
Secundino HernándezSecundino Hernández

Secundino HernándezSecundino Hernández

Secundino HernándezSecundino Hernández

Secundino HernándezSecundino Hernández
CM
2025 feiert die Friedrichs Foundation in Weidingen als zweite von 3 Institutionen Deinen 50. Geburtstag. Die Sala Alcalá 31 in Madrid und das Museo de Arte Contemporáneo in León sind die anderen beiden. Steht jede der 3 Ausstellungen für sich oder sind sie konzeptionell verbunden?
SH
Streng genommen sind sie nicht als Trilogie gedacht, aber es gibt durchaus eine zugrunde liegende Kontinuität – eher eine Reihe von Entsprechungen als eine einzige Erzählung. Jede Ausstellung reagiert auf ihre eigene Geografie, Architektur und Geschwindigkeit. Die Sala Alcalá 31 markierte eine Rückkehr zu meinen Anfängen, tatsächlich und im übertragenen Sinn. Eine Reflektion über Ursprünge – über die Konstanz bestimmter Materialien, Gesten und Fragen, die mich über die Jahre begleitet haben.
Die Ausstellung in der Friedrichs Foundation ist introspektiver, auf langsames Betrachten angelegt. Weidingen lädt zur Stille ein – zu einer Nähe von Malerei und Betrachtung, die man in der Großstadt selten hat. Dafür habe ich Bilder ausgewählt, die unter der Oberfläche in Spannung stehen, die sich erst mit der Zeit entfalten. Ein konzentrierter Blick, der Präsenz statt Spektakel ermöglicht.
Demgegenüber öffnet León das Feld. Das MUSAC ist ein großer und komplexer Ort. Das lädt zu einer weiter gefassten Auseinandersetzung ein – neue Werke im Dialog mit früheren Momenten. Ging es in Madrid um die Ursprünge und in Weidingen um das Wesentliche, weist León vielleicht auf die Zukunft, auf das Uneingelöste. Also ja, sie sind alle unabhängig voneinander, doch wie 3 Spiegel zeigen sie aus unterschiedlichen Perspektiven dasselbe Werk.
CM
Wie hast Du Brunhilde und Günther Friedrichs kennengelernt? Sie gehören zu Deinen enthusiastischsten Sammlern und ihre Sammlung umfasst nahezu 50 Werke – auf Leinwand und Papier. Die frühesten sind Mitte der 2000er, die jüngsten erst vor kurzem entstanden. Wie ist Eure Beziehung? Seht oder sprecht Ihr regelmäßig?
SH
Wir haben uns in den frühen 2010ern kennengelernt und was unsere Verbindung vertieft hat, war die gemeinsame Sensibilität für Malerei – eine tiefe, fast intuitive Auseinandersetzung mit den Werken selbst. Sie sammeln keine Moden oder aus Spekulation. Ihre Art, sich der Malerei zu nähern, zeugt von einer persönlichen Vertrautheit und im Laufe der Jahre hat unsere Verbindung das übliche Künstler / Sammler-Verhältnis weit überschritten. Wir sind regelmäßig in Kontakt, besonders wenn sie in Madrid sind, und ich schätze und genieße unsere Gespräche sehr. Wenn sie ins Atelier kommen, sehen sie die Bilder nicht nur mit den Augen, sondern mit Zuneigung und Aufmerksamkeit. Solche Hingabe ist selten.
CM
Friedrichs’ teilen eine lebhafte Leidenschaft für Spanien. Deshalb war es in den späten 1980ern ganz natürlich für sie, das Sammeln mit spanischen Künstlern zu beginnen, allen voran Joan Miró, Antoni Tàpies, Antonio Saura und ihr enger Freund und Wahl-Ibizenker Erwin Bechtold. Das ist ein Grund, warum ihr Interesse an Deinem Werk so naheliegend ist. Allerdings interessiert mich Dein Verhältnis zur spanischen Tradition. Offensichtlich beziehst Du Dich auf die grundlegenden Errungenschaften von El Greco, Velázquez und Goya und integrierst sie in Deine Arbeit.
SH
Ja, aber nicht als direkte Zitate. Ich bin inmitten der spanischen Malereitradition aufgewachsen – nicht nur historisch, sondern sinnlich. Velázquez’ Ernst, Goyas seelische Spannung, die Mystik von El Greco – ich trage das alles in mir. Ihr Einfluss ist jedoch eher strukturell denn thematisch. Sie machten mir klar, dass ein Gemälde Abwesenheit, Vieldeutigkeit, Widerstand vereinen kann. Wohingegen spätere Figuren wie Saura und Tàpies die gesamte Bildfläche neu bestimmt haben – sie wurde zu einem Schlachtfeld, zu einem Ort politischer und poetischer Selbstbehauptung. Das entspricht mir sehr.
CM
Und mehr noch. In Deinen Bildern Ende der 2000ern beeindruckte mich immer besonders, wie Du die Schärfe von Picassos und Juan Gris' kubistischer Motivfragmentierung innerhalb des Bildraums und die damit verbundene malerische Selbstreflexion mit der luftigen Zartheit von Joan Miró oder dem aberwitzigen Aufruhr von Dalís Surrealismus verbunden hast.
SH
Diese Verbindung von Klarheit und Unordnung ist ein wesentlicher Teil meiner Arbeit. Der Kubismus brachte mir die Konstruktion bei – wie der Bildraum neu zu ordnen ist, um die Wahrnehmung in Frage zu stellen. Miró gab mir Leichtigkeit und Dalí – selbst wenn er weit weg von meiner eigenen Sprache ist – zeigte mir, wie aus Form Halluzination oder, besser, Illusion werden kann. Meine Malerei bewegt sich oft zwischen Kontrolle und Auflösung, zwischen Analyse und Instinkt. Ich versuche erst gar nicht, diese Spannungen aufzulösen – ich bringe sie in Balance und lasse sie koexistieren.
CM
Und die Amerikaner? Der Abstrakte Expressionismus und die Folgen werden selten erwähnt, wenn Dein Werk kritisch besprochen wird.
SH
Der Einfluss ist da, auch wenn er nicht so oft wahrgenommen wird. Die amerikanischen gestischen Maler waren ein Beispiel für mich, dass Malerei nicht allein im Schaffen von Bildern besteht, sondern selbst eine Handlung ist – eine materielle Performance. Das ist befreiend, aber ihre formale Rhetorik entspricht mir nicht wirklich. Meine Gesten sind innerlicher, weniger deklarativ. Ich arbeite mit einer mediterranen Sensibilität – ich folge meiner Intuition, auch dann noch, wenn ich sie durch Konstruktion oder Zurückhaltung ausgleiche.
CM
Worüber immer gesprochen wird, ist die deutsche Malerei. Schon in Madrid, während Deines Studiums, hast Du Dich mit der deutschen Malerei der 1980er beschäftigt. Und noch wichtiger, von 2008 bis 2017 hast Du in Berlin gelebt und warst Teil der lebendigen jungen Kunstszene dort – so haben wir uns auch kennengelernt. Wie hat Berlin Deine Malerei beeinflusst?
SH
Berlin hat meinen Horizont erweitert und mir Raum gegeben, wörtlich und sinnbildlich, um die Malerei neu zu denken. Der Austausch mit den deutschen Malern – ihre Auseinandersetzung mit der Geschichte, ihre schonungslose Materialität – war prägend. Ich habe gelernt, Risiken einzugehen und Fehler als Teil des Schaffens zu akzeptieren. Die Stadt selbst hat meinen Rhythmus geprägt. Ihre Energie ist unberechenbar, aber fruchtbar. Das hat mir erlaubt, den Einsatz zu erhöhen, offener für Prozesse und strenger in der Struktur zu werden.
CM
Das bringt uns zu Deiner Ausstellung in Weidingen. Du hast Gemälde aus den vergangenen 10 Jahren ausgewählt – reife Werke, sozusagen. Warum gerade diese 9 Bilder?
SH
Ich wollte keine Retrospektive. Ich wollte, dass die Auswahl atmet – dass sie dicht ist, ohne erzählerisch zu sein. Jedes der 9 Bilder stellt einen Wendepunkt dar, formal und emotional. Es sind innere Umbrüche, nicht äußere ›Meilensteine‹. An einem Ort wie Weidingen, wo sich die Zeit dehnt und Kontemplation möglich ist, wollte ich die Begegnung verlangsamen. Es sind Bilder, die die lange Betrachtung belohnen.
CM
Im Rückblick auf 30 Jahre Malerei hast Du 4 konstante Themen oder Zugänge formuliert, die Dein gesamtes Œuvre charakterisieren: »Zeichnung«, »Oberfläche«, »Form« und »Figur«. Fangen wir mit der »Zeichnung« an. Dein Strich als Zeichner ist ziemlich auffällig und persönlich. Lose über die Fläche verteilt und aufgeputscht erzeugt er erhebliche Unruhe für alle herkömmlichen Konturen.
SH
Zeichnen ist meine Muttersprache. Instinktiv, aber nicht automatistisch. Meine Linien sind gleichermaßen von Zweifel und Energie getragen und das kann ich modulieren. Sie definieren nicht, sie hinterfragen. So destabilisiere ich Strukturen und schaffe Brüche. Mir geht es nicht um zeichnerische Schönheit – ich strebe nach Vitalität, nach einem Puls. Für mich ist die Zeichnung der Malerei niemals untergeordnet. Sie ist Malerei in reinster Form.
CM
Die Motive verlieren und finden sich ständig wieder, schwinden und erscheinen von neuem. Nimm nur Velázquez oder Picasso ... Allerdings scheint es mir, dass solche Brüche nicht schwer zu bewerkstelligen sind, weitaus schwieriger ist es, den Gesamtzusammenhang des Gemäldes zu erreichen.
SH
Ganz sicher. Dinge zu zerbrechen, ist immer leicht. Die Herausforderung besteht hingegen darin, sie gemeinsam atmen zu lassen – Brüche zusammenzufügen, ohne ihre Spannung aufzuheben. Ich versuche, das Bild porös, instabil, aber doch ganz zu halten. Es soll lebendig sein, nicht erledigt.
CM
Erstaunlicherweise ordnest Du auch Deine genähten Bilder – beispielsweise Foresta Negra, 2018 – der »Zeichnung« zu. Wie kommt das?
SH
Weil sie derselben Logik folgen. Die Naht ist eine andere Art von Linie – eine, die schneidet, verbindet und Narben hinterlässt. Sie besitzt Rhythmus, Richtung, Zerbrechlichkeit. In solchen Werken ist die Geste langsamer, entschiedener. Aber immer noch Geste – eine Zeichnung mit einem Faden, mit materieller Erinnerung. Innerhalb der Struktur des Gemäldes wird sie zu einer unerschütterlichen Konstruktion.
CM
Die »Oberflächen« stellen sich wiederum unmittelbar dem malerischen Prozess. Die Bilder zeichnen sich entweder durch eine enorme Masse an Farbe aus oder die fast vollständige Abwesenheit derselben. Sie umfassen sowohl den Aufbau einer dichten malerischen Oberfläche durch Überladung und schiere Anhäufung als auch den rückhaltlosen Abbau des farbigen Materials durch Auslöschung und Abschürfung. Sind diese gegensätzlichen Zustände in Deiner Malerei ein und dasselbe?
SH
Sie sind untrennbar. Anhäufen und Auslöschen sind beides Akte der Einschreibung. Für mich ist die Oberfläche wie ein Terrain, ein Archiv oder eine Ansammlung von Gesten. Bedecken ist Schützen, Abdecken Enthüllen. Deswegen ist der Gegensatz von Fülle und Leere auch kein Konflikt – es ist ein Dialog. Dasselbe gilt für die zeichnerische Linie gegenüber der malerischen Sprache: zusammen erzeugen sie Reibung, sind aber Partner im selben Tanz. Malerei ist nie Ergebnis – sie ist ein Zustand.
CM
Wie hältst Du Deine sogenannten »Palettenbilder« wie Ohne Titel, 2017, oder Ohne Titel, 2021, die aus ungeheuren Massen pastoser Farbe bestehen, malerisch unter Kontrolle?
SH
Ich kontrolliere sie nicht – ich verhandle mit ihnen. Das sind meine prozessualsten und freiesten Werke. Die Bilder entstehen aus den Resten anderer Bilder und teilen deren Körperlichkeit. Sie häufen sich an wie Sediment. Ich greife rhythmisch ein, nicht aber kompositorisch. Das Bild sagt mir, wenn es einen gewissen Sättigungsgrad erreicht hat, wenn es anfängt, etwas jenseits der bloßen Anhäufung auszusprechen. Es ist eine Form des Aufeinanderhörens.
CM
Sind sie mit Eugène Leroy, Frank Auerbach, Francis Bacons Ateliertür, die er als überlebensgroße Palette benutzt hat, Georg Baselitz’ kruder Anhäufung von Farben (Skulptur, 1960) oder Glenn Browns skulpturalen Experimenten verwandt?
SH
Sicher. Ich bewundere ihre radikale Materialität und erkannte, dass die Rückstände der Malerei selbst Bild werden können. Aber meine Beziehung dazu ist wieder intuitiv, nicht theoretisch. Meine Palettenbilder entstanden aus einer Ateliergewohnheit – als Erinnerung an einen Prozess, eine Art von Tagebuch – vom Boden zu den Schabewerkzeugen. Erst viel später wurden mir die kunsthistorischen Echos bewusst.
CM
In der »Zeichnung« und auf der »Oberfläche« spürt man äußerste Fragilität. Die von Hand gezeichneten, skripturalen Linien zittern, die ausgelöschten Flächen halten kaum mehr zusammen oder sind massiv überladen. Das Bild wird unentwegt in Frage gestellt, wir Betrachter ebenfalls. Es gibt das berühmte Zitat von Philip Leider, dass »das Wesen der Malerei Farbe« sei, Farbe und Oberfläche, doch würdest Du sagen, dass in Deinen Bildern mehr steckt als ihre schnöde Materialität? Etwas, das unsere gelebten Erfahrungen und unsere zerbrechliche Konstitution herausfordert, uns aus der Bahn wirft?
SH
Absolut. Die Materialität ist das Mittel, nicht die Botschaft. Ich frage mich immer, wie Malerei Zerbrechlichkeit, Zweifel und Präsenz ausdrücken kann. Wir sind zerbrechlich! Ich möchte, dass das Bild atmet und zittert – sich provisorisch anfühlt, wie eine Spur oder Erinnerung. Ein Gemälde muss offen bleiben, verletzlich – so wie wir.
CM
»Form« hingegen benennt suprematistisch anmutende Gemälde mit geometrischen Elementen, selbstgenügsamen Strichen oder Farbflecken, die rhythmisch über das Bildfeld verteilt sind, und den Überresten von Konturen oder figürlichen Motiven. Selbst wenn diese Werke einige Gemeinsamkeiten mit den ersten beiden Gruppen aufweisen, was sind ihre unverwechselbaren Eigenschaften?
SH
Es sind Versuche von Ordnung, aber provisorische. Sie zeigen Grenzen auf und Zumutungen. Ihre Form suggeriert eine gewisse Logik, widersetzt sich aber jedweder Hierarchie. Sie sind aus der Zeichnung abgeleitet und streben doch nach Struktur. Visuell atmen sie – Zeichen des Schweigens inmitten turbulenterer Zustände. Grenzen …
CM
Und schließlich »Figur«. Man könnte Dich leicht einen abstrakten Maler nennen, aber Deine Bilder sind von Anfang an, seit den 1990ern, immer auch figurativ. Unterscheidest Du zwischen Figuration und Abstraktion in Deiner Malerei?
SH
Ich würde Abstraktion und Figuration nicht voneinander trennen, nein. In meiner Malerei sind das keine Gegensätze, vielmehr 2 Arten, sich demselben Rätsel zu nähern – der Präsenz des gemalten Körpers. Die Figur ist immer da, manchmal klar umrissen, manchmal zerstreut, ausgelöscht oder unter der Oberfläche verborgen. Sogar in meinen gestischsten oder scheinbar abstraktesten Bildern gibt es oft Überbleibsel von Anatomie, die Spur einer menschlichen Geste. Einen Körper auf herkömmliche Weise abzubilden, reizt mich überhaupt nicht. Was mich umtreibt, ist seine Erinnerung – ihre Resonanz in den Linien, die Spannung und Dichte der Fläche. Für mich ist die Figuration kein Bild – sie ist eine Heimsuchung. Etwas, das bestehen bleibt, selbst wenn es schon längst nicht mehr sichtbar ist.
CM
Viele Deiner Bilder materialisieren sich und schwinden im selben Augenblick, wie Phantome. Statt eindeutig zu seinen, scheinen sie spurenhaft. Denkst Du über solche Dinge nach?
SH
Ja, sehr sogar! Ich wünsche mir, dass meine Bilder fortdauern, dass sie Fragen aufwerfen – nicht behaupten oder verordnen, sondern suggerieren. Für mich ist ein gutes Gemälde wie eine halbe Erinnerung: es bleibt bei einem, verändert sich, fordert etwas von uns.
CM
Und die Bilder sind offen. Es gibt kein zentrales Motiv oder unterschwellige Kompositionsstruktur. Stattdessen dehnen sie sich aus einem leeren Zentrum in unendlicher Frontalität aus. Visuell schweben und treiben sie, strahlen, vibrieren und schimmern. Eine heftige Herausforderung für uns, oder nicht?
SH
Diese Offenheit ist ganz wesentlich. Ich biete ja keine Botschaften, sondern Begegnungen. Bilder sollten unseren Blick empfangen, aber nicht leiten. Ich möchte Möglichkeitsräume schaffen – Räume, in denen die Unsicherheit andauert. Erst, wenn es vibriert, sich lebendig anfühlt, erfüllt sich ein Werk.
Die Offenheit ist auch Ausdruck des Vertrauens in den Betrachter. Ich will das Bild ja nicht in Erklärungen einschnüren, es soll durchlässig bleiben. Für mich illustriert Malerei keine Gedanken – sie denkt vielmehr in materieller Form. Sie ist ein Ort, an dem Bedeutung ausgehandelt und nicht vorgegeben wird. Deshalb sträube ich mich so sehr gegen narrative Geschlossenheit. Vieldeutigkeit ist mir lieber als Eindeutigkeit, Spannung lieber als Auflösung.
Loslassen hat auch etwas für sich – dem Gemälde erlauben, zu sein, was es sein will. Nach langer Zeit ist mir klar geworden, dass Kontrolle nur ein Teil des Prozesses ist, der Rest ist Aufmerksamkeit, Geduld, Zweifel. Manche dieser Ideen leuchteten mir schon früh ein, durch Gespräche, in denen die Malerei nicht als statisches Bild, sondern als regelrechte Lebenskraft verstanden wurde. So lernte ich, dass das Wichtigste in einem Bild nicht das ist, was es zeigt, sondern jenes, das es verbirgt – das es in der Betrachtung hervorruft, verstört oder andauern lässt.
Vielleicht ist es genau das, was auch meine Malerei andauern lässt: nicht zum Abschluss zu kommen und stattdessen bereit zu sein, das Uneingelöste auszuhalten. Im Vertrauen darauf, dass etwas Wesentliches genau in und aus solcher Ungewissheit entstehen wird. Die Malerei lebt zwischen Anwesenheit und Verschwinden, zwischen Wissen und Nicht-Wissen. Zuletzt ist die Malerei die stillste und zugleich eigenwilligste Art und Weise, die ich gefunden habe, um auszusprechen, was man nicht sagen kann.
Secundino Hernández im Gespräch mit Christian MalychaCM
In 2025, the Friedrichs Foundation in Weidingen is the second of 3 institutions celebrating your 50th birthday. Sala Alcalá 31 in Madrid and the Museo de Arte Contemporáneo in León being the other 2. Does each of the 3 exhibitions stand for itself or are they conceptually connected?
SH
They have not been conceived as a trilogy in the formal sense, but there is certainly an underlying continuity—more of a set of correspondences than a single narrative. Each exhibition responds to its own geography, architecture and tempo. Sala Alcalá 31 marked a return to my point of departure, both physically and metaphorically. It reflected on origins—on the persistence of certain materials, gestures and questions that have remained with me over the years.
The exhibition at the Friedrichs Foundation is more introspective, more attuned to the act of looking slowly. Weidingen allows for silence—for a kind of proximity between painting and viewer that is rare in metropolitan contexts. Here, I’ve chosen works that hold tension beneath the surface, that unfold over time. It’s a concentrated view, one that prioritizes presence over spectacle.
And León, in contrast, opens up the field. The MUSAC is a place of scale and complexity. It invites a broader articulation—new works will appear there in dialogue with earlier moments. If Madrid was about origins and Weidingen about essence, León perhaps alludes toward the future, toward the unresolved. So, yes—they are autonomous, but like 3 mirrors angled differently around the same body of work.
CM
How did you get to know Brunhilde and Günther Friedrichs, in the first place? They are some of your most enthusiastic collectors and their collection includes almost 50 works of yours—both on canvas and paper. The earliest ones date from the mid-2000s, the latest ones from only quite recently. How’s your relation? Do you meet or speak on a regular basis?
SH
We met through in the early 2010s, but what solidified our connection was a shared sensitivity towards painting—a deep, almost intuitive engagement with the work itself. They don’t collect out of trend or speculation. There is a personal intimacy in how they approach the works and over time our bond has grown beyond the artist / collector framework. We’re in contact regularly, mainly when they’re in Madrid, and I truly value and enjoy our conversations. When they visit the studio, they look at the paintings not just with the eye, but with attention and affection. Such commitment is quite rare.
CM
The Friedrichs’ share a lively passion for Spain. And when they started to collect in the late 1980s, it felt only natural to them to begin with Spanish artists, namely Joan Miró, Antoni Tàpies, Antonio Saura and their close friend and Ibizan-by-choice Erwin Bechtold. That’s one reason, their interest in your work is all the more obvious. But I am keen to know your relation to the Spanish tradition? Of course you have referenced and integrated the seminal achievements of El Greco, Velázquez and Goya into your practice, haven’t you?
SH
Yes, though not through direct citation. Spain’s painting tradition is something I grew up with—not just historically, but sensorially. The weight of Velázquez, the psychological charge of Goya, the mysticism of El Greco—they all inhabit a space within me. Their influence is structural rather than thematic. They taught me how the image can hold absence, ambiguity, resistance. And of course, later figures like Saura and Tàpies redefined the surface itself—they made it a battlefield, a place of political and poetic assertion. I feel aligned with that.
CM
There is more, though. Especially, in your late 2000s works, it always seemed to me that there is a sense of both the austereness of Picasso’s and Juan Gris’ Cubist fracturing of the motifs within the pictorial space and the painterly self-reflection that comes with that as well as the airy tenderness of Joan Miró or the crazed agitation of Dalí’s Surrealism.
SH
That mixture of clarity and disorder is very much part of how I work. Cubism taught me the discipline of construction—how the pictorial space can be reorganized to question perception. Miró gave me levity and Dalí—even if distant from my own language—showed me how form can become hallucination or, better said, illusion. My work often hovers between control and dissolution, between the analytical and the instinctive. I don’t aim to reconcile those tensions—I let them harmonize and coexist.
CM
And the Americans? Abstract Expressionism and its aftermath is seldomly mentioned, when your work is critically discussed.
SH
They are present, even if not always acknowledged. The American gestural painters taught me that painting is not only image-making, but an act—a performance with the material. There is something liberating in that, but I don’t fully inhabit their rhetoric. My gestures are more internal, less declarative. I work with a Mediterranean sensibility—I let intuition lead, but I balance it with construction, even restraint.
CM
What is being referred to, however, is German painting. Already in Madrid, during your time at the academy, you studied 1980s German painting. More importantly, you lived in Berlin from 2008 to 2017 and were yourself a vital part of the young art scene there—that’s when we got to know each other. How did the Berlin circumstances impact your painting?
SH
Berlin expanded my field of vision. It gave me space, both literal and conceptual, to reconsider painting. The dialogue with German painters—their confrontation with history, their unapologetic materiality—was formative. It taught me to take risks, to accept failure as part of the process. The city itself also shaped my rhythm. Its energy is erratic, but generative. It allowed me to shift scales, to be more open with process and more rigorous in structure.
CM
This brings us directly to your exhibition in Weidingen. For it, you have chosen paintings from the last decade—mature ones, so to speak. Why these particular 9 paintings?
SH
I didn’t want a retrospective. I wanted a selection that breathes—one that offers density without narrative. Each of these 9 works marks a turning point, either formally or emotionally. They represent internal shifts, not external ›milestones‹. In a setting like Weidingen, where time stretches and contemplation is possible, I wanted to slow down the encounter. These are paintings that reward duration.
CM
Looking back on 30 years of painting, you have formulated 4 ongoing themes or approaches that characterize your entire œuvre: »drawing«, »surface«, »form« and »figure«. Let’s start with »drawing«. Your line as a draftsman is pretty unique and highly personal. It’s loosely scattered about the plane, agitated and creates significant disturbance to any conventional contours.
SH
Drawing is my first language. It’s instinctive, but not purely automatic. My line carries hesitation and also a certain energy that I can modulate. It doesn’t define, it questions. I use it to destabilize structure, to create rupture. I don’t aim for beauty in line—I aim for vitality, a pulse. For me, drawing is not subordinate to painting. It is painting, in its most distilled form.
CM
Motifs are constantly lost and found again, submerged and recovered. Just take Velázquez or Picasso … But while such ruptures are not hard to make, achieving the overall cohesion of the painting is far more difficult, I imagine.
SH
Indeed. It’s easy to break things apart. The challenge is to let them breathe again—to make the fractures coherent without erasing their tension. I try to keep the painting porous, unstable but whole. I want it to feel alive, not resolved.
CM
Curiously enough, you also categorize your stitched paintings—Foresta Negra, 2018, for instance—as »drawing«. How come?
SH
Because they emerge from the same logic. Stitching is another kind of line—one that cuts, joins and scars. It has rhythm, direction, fragility. In those works, the gesture is slower, more deliberate. But it’s still a gesture—a drawing with thread, with material memory. Inserted into the structure of the canvas, it becomes an unremovable construction.
CM
»Surfaces«, on the other hand, appear to be addressing the painterly process more immediately. As this group includes an abundance of as well as an almost complete void of colors. The paintings equally address the build-up of a dense painterly surface by means of overloading and sheer amassing as well as its dismantling by means of erasure and abrasion of painterly matter. Are such contrary states one and the same in your painting?
SH
They are inseparable. Accumulating and erasing are both acts of inscription. I see the surface as a terrain, an archive or accumulation of gestures. To cover is to protect, to remove is to reveal. The contrast between density and void is not a conflict—it’s a dialogue. Like the graphical line against the pictorial language: creating frictions, but being partners in the same dance. Painting is not a result—it’s a condition.
CM
How do you keep your so-called »Palette Paintings« like Untitled, 2017, or Untitled, 2021, which are comprised of immense masses of thick patches of pastose color, painterly under control?
SH
I don’t control them—I negotiate with them. In fact, I consider them my most processual and free-form works. These paintings come from the leftovers of other paintings and share that physicality. They accumulate like sediment. I intervene rhythmically, not compositionally. The painting tells me when it has reached a point of saturation, when it begins to articulate something beyond accumulation. It’s a form of listening.
CM
Do they have any kinship with Eugène Leroy, Frank Auerbach, Francis Bacon’s studio door, which he used as a larger than life palette, Georg Baselitz’ unique pile of sculpted colors (Sculpture, 1960) or Glenn Brown’s sculptural experiments?
SH
Certainly. I admire their radical materiality. They taught me that the residue of painting can itself become an image. But my relationship to them is intuitive, not theoretical. My Palette Paintings started from a studio habit—as a memory of a process, a sort of diary—from the floor to the scraping tools. Only later did I recognize their art historical echoes.
CM
Both in your »drawing« and your »surface« paintings there is a most tangible feel of fragility. The hand-drawn, scriptural lines tremble, the eradicated planes barely hold themselves together or are massively overburdened. The image itself is contested at all times and so are we beholders. There might be the famous quote by Philip Leider that »the thing in painting is color«, color and surface, but would you agree that there is more to your paintings than their mere materiality? Something that challenges all our lived experiences and frail composures.
SH
Absolutely. Materiality is the medium, not the message. What interests me is how painting can evoke fragility, doubt and presence. We are fragile! I want the image to breathe and tremble—to feel provisional, like a trace or a memory. The painting must remain open, vulnerable—as we are.
CM
»Form«, in turn, includes paintings with geometric shapes, almost like a Suprematist allusion, self-contained strokes or patches of color rhythmically shuffled and spread across the pictorial field, remnants of contours or figurative motifs. Even if these paintings share some characteristics with the 2 prior groups, what are their distinctive properties?
SH
They are attempts at order, but provisional. They speak to us of limits and impositions. In these works, the forms suggest logic, but resist hierarchy. They are derived from drawing, but aspire to structure. They are visual breaths—marks of silence between more turbulent states. Boundaries …
CM
And finally »figure«. You might generally be considered as an abstract painter, but your work has always been figurative, right from the start in the 1990s. Would you actually make a difference between figuration and abstraction in painting?
SH
I wouldn’t draw a strict line between figuration and abstraction. They are not opposites in my practice, but rather two modes of approaching the same enigma—the presence of the body in painting. The figure has always been there, sometimes clearly outlined, at other times dispersed, erased or veiled beneath the surface. Even in my most gestural or seemingly abstract works, there’s often a residue of anatomy, a trace of the human gesture. I’m not interested in depicting the body in a traditional sense, but in evoking its memory—how it vibrates through line, tension, density. Figuration, for me, is not an image—it’s a haunting. Something that persists, even when it’s no longer visible.
CM
Most of your paintings, materialize and fade at the same time, like spectres. Instead of being definitive, they have a trace-like quality. Do you care for such things?
SH
Yes, very much so! I want my paintings to endure, to question—not to assert or impose, but to suggest. For me, a good painting is like a half-memory: it stays with you, it changes, it demands something of you.
CM
And your paintings are open. They do not have a central motif nor a compositional support structure beneath. They rather expand from an empty center into an indefinite frontality. Visually, they float and drift, they radiate, vibrate and glisten. Quite a delicate challenge for any beholder, isn’t it?
SH
That openness is essential. I’m not offering a message, but an encounter. The paintings should receive the gaze, not direct it. I want to create a field of possibility—a space where uncertainty can be sustained. If it vibrates, if it feels alive, then it has done its work.
This openness is also a way of trusting the viewer. I don’t want to anchor the work in explanation, I want it to remain permeable. Painting, for me, is not an illustration of thought—it is thought in material form. It’s a site where meaning is negotiated, not imposed. That’s why I resist narrative closure. I prefer ambiguity over certainty, tension over resolution.
There’s also something about letting go—about allowing the painting to be what it wants to be. I’ve learned over time that control is only part of the process, the rest is attention, patience, doubt. Some of these ideas were reinforced early in my career by conversations with those who truly understand painting not as a static image, but as a living force. People who taught me that what matters most in a painting is not what it shows, but what it withholds—what it provokes, disorients or sustains in the viewer.
And perhaps that’s what sustains my practice, too: not the arrival at conclusions, but the willingness to stay in the unresolved. The trust that something essential might emerge precisely in or from that instability. That’s where painting lives—between presence and disappearance, between knowing and not-knowing. In the end, painting is the most silent, yet stubborn way I have found to speak about what can’t be said.
Secundino Hernández in conversation with Christian Malycha
2025 feiert die Friedrichs Foundation in Weidingen als zweite von 3 Institutionen Deinen 50. Geburtstag. Die Sala Alcalá 31 in Madrid und das Museo de Arte Contemporáneo in León sind die anderen beiden. Steht jede der 3 Ausstellungen für sich oder sind sie konzeptionell verbunden?
SH
Streng genommen sind sie nicht als Trilogie gedacht, aber es gibt durchaus eine zugrunde liegende Kontinuität – eher eine Reihe von Entsprechungen als eine einzige Erzählung. Jede Ausstellung reagiert auf ihre eigene Geografie, Architektur und Geschwindigkeit. Die Sala Alcalá 31 markierte eine Rückkehr zu meinen Anfängen, tatsächlich und im übertragenen Sinn. Eine Reflektion über Ursprünge – über die Konstanz bestimmter Materialien, Gesten und Fragen, die mich über die Jahre begleitet haben.
Die Ausstellung in der Friedrichs Foundation ist introspektiver, auf langsames Betrachten angelegt. Weidingen lädt zur Stille ein – zu einer Nähe von Malerei und Betrachtung, die man in der Großstadt selten hat. Dafür habe ich Bilder ausgewählt, die unter der Oberfläche in Spannung stehen, die sich erst mit der Zeit entfalten. Ein konzentrierter Blick, der Präsenz statt Spektakel ermöglicht.
Demgegenüber öffnet León das Feld. Das MUSAC ist ein großer und komplexer Ort. Das lädt zu einer weiter gefassten Auseinandersetzung ein – neue Werke im Dialog mit früheren Momenten. Ging es in Madrid um die Ursprünge und in Weidingen um das Wesentliche, weist León vielleicht auf die Zukunft, auf das Uneingelöste. Also ja, sie sind alle unabhängig voneinander, doch wie 3 Spiegel zeigen sie aus unterschiedlichen Perspektiven dasselbe Werk.
CM
Wie hast Du Brunhilde und Günther Friedrichs kennengelernt? Sie gehören zu Deinen enthusiastischsten Sammlern und ihre Sammlung umfasst nahezu 50 Werke – auf Leinwand und Papier. Die frühesten sind Mitte der 2000er, die jüngsten erst vor kurzem entstanden. Wie ist Eure Beziehung? Seht oder sprecht Ihr regelmäßig?
SH
Wir haben uns in den frühen 2010ern kennengelernt und was unsere Verbindung vertieft hat, war die gemeinsame Sensibilität für Malerei – eine tiefe, fast intuitive Auseinandersetzung mit den Werken selbst. Sie sammeln keine Moden oder aus Spekulation. Ihre Art, sich der Malerei zu nähern, zeugt von einer persönlichen Vertrautheit und im Laufe der Jahre hat unsere Verbindung das übliche Künstler / Sammler-Verhältnis weit überschritten. Wir sind regelmäßig in Kontakt, besonders wenn sie in Madrid sind, und ich schätze und genieße unsere Gespräche sehr. Wenn sie ins Atelier kommen, sehen sie die Bilder nicht nur mit den Augen, sondern mit Zuneigung und Aufmerksamkeit. Solche Hingabe ist selten.
CM
Friedrichs’ teilen eine lebhafte Leidenschaft für Spanien. Deshalb war es in den späten 1980ern ganz natürlich für sie, das Sammeln mit spanischen Künstlern zu beginnen, allen voran Joan Miró, Antoni Tàpies, Antonio Saura und ihr enger Freund und Wahl-Ibizenker Erwin Bechtold. Das ist ein Grund, warum ihr Interesse an Deinem Werk so naheliegend ist. Allerdings interessiert mich Dein Verhältnis zur spanischen Tradition. Offensichtlich beziehst Du Dich auf die grundlegenden Errungenschaften von El Greco, Velázquez und Goya und integrierst sie in Deine Arbeit.
SH
Ja, aber nicht als direkte Zitate. Ich bin inmitten der spanischen Malereitradition aufgewachsen – nicht nur historisch, sondern sinnlich. Velázquez’ Ernst, Goyas seelische Spannung, die Mystik von El Greco – ich trage das alles in mir. Ihr Einfluss ist jedoch eher strukturell denn thematisch. Sie machten mir klar, dass ein Gemälde Abwesenheit, Vieldeutigkeit, Widerstand vereinen kann. Wohingegen spätere Figuren wie Saura und Tàpies die gesamte Bildfläche neu bestimmt haben – sie wurde zu einem Schlachtfeld, zu einem Ort politischer und poetischer Selbstbehauptung. Das entspricht mir sehr.
CM
Und mehr noch. In Deinen Bildern Ende der 2000ern beeindruckte mich immer besonders, wie Du die Schärfe von Picassos und Juan Gris' kubistischer Motivfragmentierung innerhalb des Bildraums und die damit verbundene malerische Selbstreflexion mit der luftigen Zartheit von Joan Miró oder dem aberwitzigen Aufruhr von Dalís Surrealismus verbunden hast.
SH
Diese Verbindung von Klarheit und Unordnung ist ein wesentlicher Teil meiner Arbeit. Der Kubismus brachte mir die Konstruktion bei – wie der Bildraum neu zu ordnen ist, um die Wahrnehmung in Frage zu stellen. Miró gab mir Leichtigkeit und Dalí – selbst wenn er weit weg von meiner eigenen Sprache ist – zeigte mir, wie aus Form Halluzination oder, besser, Illusion werden kann. Meine Malerei bewegt sich oft zwischen Kontrolle und Auflösung, zwischen Analyse und Instinkt. Ich versuche erst gar nicht, diese Spannungen aufzulösen – ich bringe sie in Balance und lasse sie koexistieren.
CM
Und die Amerikaner? Der Abstrakte Expressionismus und die Folgen werden selten erwähnt, wenn Dein Werk kritisch besprochen wird.
SH
Der Einfluss ist da, auch wenn er nicht so oft wahrgenommen wird. Die amerikanischen gestischen Maler waren ein Beispiel für mich, dass Malerei nicht allein im Schaffen von Bildern besteht, sondern selbst eine Handlung ist – eine materielle Performance. Das ist befreiend, aber ihre formale Rhetorik entspricht mir nicht wirklich. Meine Gesten sind innerlicher, weniger deklarativ. Ich arbeite mit einer mediterranen Sensibilität – ich folge meiner Intuition, auch dann noch, wenn ich sie durch Konstruktion oder Zurückhaltung ausgleiche.
CM
Worüber immer gesprochen wird, ist die deutsche Malerei. Schon in Madrid, während Deines Studiums, hast Du Dich mit der deutschen Malerei der 1980er beschäftigt. Und noch wichtiger, von 2008 bis 2017 hast Du in Berlin gelebt und warst Teil der lebendigen jungen Kunstszene dort – so haben wir uns auch kennengelernt. Wie hat Berlin Deine Malerei beeinflusst?
SH
Berlin hat meinen Horizont erweitert und mir Raum gegeben, wörtlich und sinnbildlich, um die Malerei neu zu denken. Der Austausch mit den deutschen Malern – ihre Auseinandersetzung mit der Geschichte, ihre schonungslose Materialität – war prägend. Ich habe gelernt, Risiken einzugehen und Fehler als Teil des Schaffens zu akzeptieren. Die Stadt selbst hat meinen Rhythmus geprägt. Ihre Energie ist unberechenbar, aber fruchtbar. Das hat mir erlaubt, den Einsatz zu erhöhen, offener für Prozesse und strenger in der Struktur zu werden.
CM
Das bringt uns zu Deiner Ausstellung in Weidingen. Du hast Gemälde aus den vergangenen 10 Jahren ausgewählt – reife Werke, sozusagen. Warum gerade diese 9 Bilder?
SH
Ich wollte keine Retrospektive. Ich wollte, dass die Auswahl atmet – dass sie dicht ist, ohne erzählerisch zu sein. Jedes der 9 Bilder stellt einen Wendepunkt dar, formal und emotional. Es sind innere Umbrüche, nicht äußere ›Meilensteine‹. An einem Ort wie Weidingen, wo sich die Zeit dehnt und Kontemplation möglich ist, wollte ich die Begegnung verlangsamen. Es sind Bilder, die die lange Betrachtung belohnen.
CM
Im Rückblick auf 30 Jahre Malerei hast Du 4 konstante Themen oder Zugänge formuliert, die Dein gesamtes Œuvre charakterisieren: »Zeichnung«, »Oberfläche«, »Form« und »Figur«. Fangen wir mit der »Zeichnung« an. Dein Strich als Zeichner ist ziemlich auffällig und persönlich. Lose über die Fläche verteilt und aufgeputscht erzeugt er erhebliche Unruhe für alle herkömmlichen Konturen.
SH
Zeichnen ist meine Muttersprache. Instinktiv, aber nicht automatistisch. Meine Linien sind gleichermaßen von Zweifel und Energie getragen und das kann ich modulieren. Sie definieren nicht, sie hinterfragen. So destabilisiere ich Strukturen und schaffe Brüche. Mir geht es nicht um zeichnerische Schönheit – ich strebe nach Vitalität, nach einem Puls. Für mich ist die Zeichnung der Malerei niemals untergeordnet. Sie ist Malerei in reinster Form.
CM
Die Motive verlieren und finden sich ständig wieder, schwinden und erscheinen von neuem. Nimm nur Velázquez oder Picasso ... Allerdings scheint es mir, dass solche Brüche nicht schwer zu bewerkstelligen sind, weitaus schwieriger ist es, den Gesamtzusammenhang des Gemäldes zu erreichen.
SH
Ganz sicher. Dinge zu zerbrechen, ist immer leicht. Die Herausforderung besteht hingegen darin, sie gemeinsam atmen zu lassen – Brüche zusammenzufügen, ohne ihre Spannung aufzuheben. Ich versuche, das Bild porös, instabil, aber doch ganz zu halten. Es soll lebendig sein, nicht erledigt.
CM
Erstaunlicherweise ordnest Du auch Deine genähten Bilder – beispielsweise Foresta Negra, 2018 – der »Zeichnung« zu. Wie kommt das?
SH
Weil sie derselben Logik folgen. Die Naht ist eine andere Art von Linie – eine, die schneidet, verbindet und Narben hinterlässt. Sie besitzt Rhythmus, Richtung, Zerbrechlichkeit. In solchen Werken ist die Geste langsamer, entschiedener. Aber immer noch Geste – eine Zeichnung mit einem Faden, mit materieller Erinnerung. Innerhalb der Struktur des Gemäldes wird sie zu einer unerschütterlichen Konstruktion.
CM
Die »Oberflächen« stellen sich wiederum unmittelbar dem malerischen Prozess. Die Bilder zeichnen sich entweder durch eine enorme Masse an Farbe aus oder die fast vollständige Abwesenheit derselben. Sie umfassen sowohl den Aufbau einer dichten malerischen Oberfläche durch Überladung und schiere Anhäufung als auch den rückhaltlosen Abbau des farbigen Materials durch Auslöschung und Abschürfung. Sind diese gegensätzlichen Zustände in Deiner Malerei ein und dasselbe?
SH
Sie sind untrennbar. Anhäufen und Auslöschen sind beides Akte der Einschreibung. Für mich ist die Oberfläche wie ein Terrain, ein Archiv oder eine Ansammlung von Gesten. Bedecken ist Schützen, Abdecken Enthüllen. Deswegen ist der Gegensatz von Fülle und Leere auch kein Konflikt – es ist ein Dialog. Dasselbe gilt für die zeichnerische Linie gegenüber der malerischen Sprache: zusammen erzeugen sie Reibung, sind aber Partner im selben Tanz. Malerei ist nie Ergebnis – sie ist ein Zustand.
CM
Wie hältst Du Deine sogenannten »Palettenbilder« wie Ohne Titel, 2017, oder Ohne Titel, 2021, die aus ungeheuren Massen pastoser Farbe bestehen, malerisch unter Kontrolle?
SH
Ich kontrolliere sie nicht – ich verhandle mit ihnen. Das sind meine prozessualsten und freiesten Werke. Die Bilder entstehen aus den Resten anderer Bilder und teilen deren Körperlichkeit. Sie häufen sich an wie Sediment. Ich greife rhythmisch ein, nicht aber kompositorisch. Das Bild sagt mir, wenn es einen gewissen Sättigungsgrad erreicht hat, wenn es anfängt, etwas jenseits der bloßen Anhäufung auszusprechen. Es ist eine Form des Aufeinanderhörens.
CM
Sind sie mit Eugène Leroy, Frank Auerbach, Francis Bacons Ateliertür, die er als überlebensgroße Palette benutzt hat, Georg Baselitz’ kruder Anhäufung von Farben (Skulptur, 1960) oder Glenn Browns skulpturalen Experimenten verwandt?
SH
Sicher. Ich bewundere ihre radikale Materialität und erkannte, dass die Rückstände der Malerei selbst Bild werden können. Aber meine Beziehung dazu ist wieder intuitiv, nicht theoretisch. Meine Palettenbilder entstanden aus einer Ateliergewohnheit – als Erinnerung an einen Prozess, eine Art von Tagebuch – vom Boden zu den Schabewerkzeugen. Erst viel später wurden mir die kunsthistorischen Echos bewusst.
CM
In der »Zeichnung« und auf der »Oberfläche« spürt man äußerste Fragilität. Die von Hand gezeichneten, skripturalen Linien zittern, die ausgelöschten Flächen halten kaum mehr zusammen oder sind massiv überladen. Das Bild wird unentwegt in Frage gestellt, wir Betrachter ebenfalls. Es gibt das berühmte Zitat von Philip Leider, dass »das Wesen der Malerei Farbe« sei, Farbe und Oberfläche, doch würdest Du sagen, dass in Deinen Bildern mehr steckt als ihre schnöde Materialität? Etwas, das unsere gelebten Erfahrungen und unsere zerbrechliche Konstitution herausfordert, uns aus der Bahn wirft?
SH
Absolut. Die Materialität ist das Mittel, nicht die Botschaft. Ich frage mich immer, wie Malerei Zerbrechlichkeit, Zweifel und Präsenz ausdrücken kann. Wir sind zerbrechlich! Ich möchte, dass das Bild atmet und zittert – sich provisorisch anfühlt, wie eine Spur oder Erinnerung. Ein Gemälde muss offen bleiben, verletzlich – so wie wir.
CM
»Form« hingegen benennt suprematistisch anmutende Gemälde mit geometrischen Elementen, selbstgenügsamen Strichen oder Farbflecken, die rhythmisch über das Bildfeld verteilt sind, und den Überresten von Konturen oder figürlichen Motiven. Selbst wenn diese Werke einige Gemeinsamkeiten mit den ersten beiden Gruppen aufweisen, was sind ihre unverwechselbaren Eigenschaften?
SH
Es sind Versuche von Ordnung, aber provisorische. Sie zeigen Grenzen auf und Zumutungen. Ihre Form suggeriert eine gewisse Logik, widersetzt sich aber jedweder Hierarchie. Sie sind aus der Zeichnung abgeleitet und streben doch nach Struktur. Visuell atmen sie – Zeichen des Schweigens inmitten turbulenterer Zustände. Grenzen …
CM
Und schließlich »Figur«. Man könnte Dich leicht einen abstrakten Maler nennen, aber Deine Bilder sind von Anfang an, seit den 1990ern, immer auch figurativ. Unterscheidest Du zwischen Figuration und Abstraktion in Deiner Malerei?
SH
Ich würde Abstraktion und Figuration nicht voneinander trennen, nein. In meiner Malerei sind das keine Gegensätze, vielmehr 2 Arten, sich demselben Rätsel zu nähern – der Präsenz des gemalten Körpers. Die Figur ist immer da, manchmal klar umrissen, manchmal zerstreut, ausgelöscht oder unter der Oberfläche verborgen. Sogar in meinen gestischsten oder scheinbar abstraktesten Bildern gibt es oft Überbleibsel von Anatomie, die Spur einer menschlichen Geste. Einen Körper auf herkömmliche Weise abzubilden, reizt mich überhaupt nicht. Was mich umtreibt, ist seine Erinnerung – ihre Resonanz in den Linien, die Spannung und Dichte der Fläche. Für mich ist die Figuration kein Bild – sie ist eine Heimsuchung. Etwas, das bestehen bleibt, selbst wenn es schon längst nicht mehr sichtbar ist.
CM
Viele Deiner Bilder materialisieren sich und schwinden im selben Augenblick, wie Phantome. Statt eindeutig zu seinen, scheinen sie spurenhaft. Denkst Du über solche Dinge nach?
SH
Ja, sehr sogar! Ich wünsche mir, dass meine Bilder fortdauern, dass sie Fragen aufwerfen – nicht behaupten oder verordnen, sondern suggerieren. Für mich ist ein gutes Gemälde wie eine halbe Erinnerung: es bleibt bei einem, verändert sich, fordert etwas von uns.
CM
Und die Bilder sind offen. Es gibt kein zentrales Motiv oder unterschwellige Kompositionsstruktur. Stattdessen dehnen sie sich aus einem leeren Zentrum in unendlicher Frontalität aus. Visuell schweben und treiben sie, strahlen, vibrieren und schimmern. Eine heftige Herausforderung für uns, oder nicht?
SH
Diese Offenheit ist ganz wesentlich. Ich biete ja keine Botschaften, sondern Begegnungen. Bilder sollten unseren Blick empfangen, aber nicht leiten. Ich möchte Möglichkeitsräume schaffen – Räume, in denen die Unsicherheit andauert. Erst, wenn es vibriert, sich lebendig anfühlt, erfüllt sich ein Werk.
Die Offenheit ist auch Ausdruck des Vertrauens in den Betrachter. Ich will das Bild ja nicht in Erklärungen einschnüren, es soll durchlässig bleiben. Für mich illustriert Malerei keine Gedanken – sie denkt vielmehr in materieller Form. Sie ist ein Ort, an dem Bedeutung ausgehandelt und nicht vorgegeben wird. Deshalb sträube ich mich so sehr gegen narrative Geschlossenheit. Vieldeutigkeit ist mir lieber als Eindeutigkeit, Spannung lieber als Auflösung.
Loslassen hat auch etwas für sich – dem Gemälde erlauben, zu sein, was es sein will. Nach langer Zeit ist mir klar geworden, dass Kontrolle nur ein Teil des Prozesses ist, der Rest ist Aufmerksamkeit, Geduld, Zweifel. Manche dieser Ideen leuchteten mir schon früh ein, durch Gespräche, in denen die Malerei nicht als statisches Bild, sondern als regelrechte Lebenskraft verstanden wurde. So lernte ich, dass das Wichtigste in einem Bild nicht das ist, was es zeigt, sondern jenes, das es verbirgt – das es in der Betrachtung hervorruft, verstört oder andauern lässt.
Vielleicht ist es genau das, was auch meine Malerei andauern lässt: nicht zum Abschluss zu kommen und stattdessen bereit zu sein, das Uneingelöste auszuhalten. Im Vertrauen darauf, dass etwas Wesentliches genau in und aus solcher Ungewissheit entstehen wird. Die Malerei lebt zwischen Anwesenheit und Verschwinden, zwischen Wissen und Nicht-Wissen. Zuletzt ist die Malerei die stillste und zugleich eigenwilligste Art und Weise, die ich gefunden habe, um auszusprechen, was man nicht sagen kann.
Secundino Hernández im Gespräch mit Christian MalychaCM
In 2025, the Friedrichs Foundation in Weidingen is the second of 3 institutions celebrating your 50th birthday. Sala Alcalá 31 in Madrid and the Museo de Arte Contemporáneo in León being the other 2. Does each of the 3 exhibitions stand for itself or are they conceptually connected?
SH
They have not been conceived as a trilogy in the formal sense, but there is certainly an underlying continuity—more of a set of correspondences than a single narrative. Each exhibition responds to its own geography, architecture and tempo. Sala Alcalá 31 marked a return to my point of departure, both physically and metaphorically. It reflected on origins—on the persistence of certain materials, gestures and questions that have remained with me over the years.
The exhibition at the Friedrichs Foundation is more introspective, more attuned to the act of looking slowly. Weidingen allows for silence—for a kind of proximity between painting and viewer that is rare in metropolitan contexts. Here, I’ve chosen works that hold tension beneath the surface, that unfold over time. It’s a concentrated view, one that prioritizes presence over spectacle.
And León, in contrast, opens up the field. The MUSAC is a place of scale and complexity. It invites a broader articulation—new works will appear there in dialogue with earlier moments. If Madrid was about origins and Weidingen about essence, León perhaps alludes toward the future, toward the unresolved. So, yes—they are autonomous, but like 3 mirrors angled differently around the same body of work.
CM
How did you get to know Brunhilde and Günther Friedrichs, in the first place? They are some of your most enthusiastic collectors and their collection includes almost 50 works of yours—both on canvas and paper. The earliest ones date from the mid-2000s, the latest ones from only quite recently. How’s your relation? Do you meet or speak on a regular basis?
SH
We met through in the early 2010s, but what solidified our connection was a shared sensitivity towards painting—a deep, almost intuitive engagement with the work itself. They don’t collect out of trend or speculation. There is a personal intimacy in how they approach the works and over time our bond has grown beyond the artist / collector framework. We’re in contact regularly, mainly when they’re in Madrid, and I truly value and enjoy our conversations. When they visit the studio, they look at the paintings not just with the eye, but with attention and affection. Such commitment is quite rare.
CM
The Friedrichs’ share a lively passion for Spain. And when they started to collect in the late 1980s, it felt only natural to them to begin with Spanish artists, namely Joan Miró, Antoni Tàpies, Antonio Saura and their close friend and Ibizan-by-choice Erwin Bechtold. That’s one reason, their interest in your work is all the more obvious. But I am keen to know your relation to the Spanish tradition? Of course you have referenced and integrated the seminal achievements of El Greco, Velázquez and Goya into your practice, haven’t you?
SH
Yes, though not through direct citation. Spain’s painting tradition is something I grew up with—not just historically, but sensorially. The weight of Velázquez, the psychological charge of Goya, the mysticism of El Greco—they all inhabit a space within me. Their influence is structural rather than thematic. They taught me how the image can hold absence, ambiguity, resistance. And of course, later figures like Saura and Tàpies redefined the surface itself—they made it a battlefield, a place of political and poetic assertion. I feel aligned with that.
CM
There is more, though. Especially, in your late 2000s works, it always seemed to me that there is a sense of both the austereness of Picasso’s and Juan Gris’ Cubist fracturing of the motifs within the pictorial space and the painterly self-reflection that comes with that as well as the airy tenderness of Joan Miró or the crazed agitation of Dalí’s Surrealism.
SH
That mixture of clarity and disorder is very much part of how I work. Cubism taught me the discipline of construction—how the pictorial space can be reorganized to question perception. Miró gave me levity and Dalí—even if distant from my own language—showed me how form can become hallucination or, better said, illusion. My work often hovers between control and dissolution, between the analytical and the instinctive. I don’t aim to reconcile those tensions—I let them harmonize and coexist.
CM
And the Americans? Abstract Expressionism and its aftermath is seldomly mentioned, when your work is critically discussed.
SH
They are present, even if not always acknowledged. The American gestural painters taught me that painting is not only image-making, but an act—a performance with the material. There is something liberating in that, but I don’t fully inhabit their rhetoric. My gestures are more internal, less declarative. I work with a Mediterranean sensibility—I let intuition lead, but I balance it with construction, even restraint.
CM
What is being referred to, however, is German painting. Already in Madrid, during your time at the academy, you studied 1980s German painting. More importantly, you lived in Berlin from 2008 to 2017 and were yourself a vital part of the young art scene there—that’s when we got to know each other. How did the Berlin circumstances impact your painting?
SH
Berlin expanded my field of vision. It gave me space, both literal and conceptual, to reconsider painting. The dialogue with German painters—their confrontation with history, their unapologetic materiality—was formative. It taught me to take risks, to accept failure as part of the process. The city itself also shaped my rhythm. Its energy is erratic, but generative. It allowed me to shift scales, to be more open with process and more rigorous in structure.
CM
This brings us directly to your exhibition in Weidingen. For it, you have chosen paintings from the last decade—mature ones, so to speak. Why these particular 9 paintings?
SH
I didn’t want a retrospective. I wanted a selection that breathes—one that offers density without narrative. Each of these 9 works marks a turning point, either formally or emotionally. They represent internal shifts, not external ›milestones‹. In a setting like Weidingen, where time stretches and contemplation is possible, I wanted to slow down the encounter. These are paintings that reward duration.
CM
Looking back on 30 years of painting, you have formulated 4 ongoing themes or approaches that characterize your entire œuvre: »drawing«, »surface«, »form« and »figure«. Let’s start with »drawing«. Your line as a draftsman is pretty unique and highly personal. It’s loosely scattered about the plane, agitated and creates significant disturbance to any conventional contours.
SH
Drawing is my first language. It’s instinctive, but not purely automatic. My line carries hesitation and also a certain energy that I can modulate. It doesn’t define, it questions. I use it to destabilize structure, to create rupture. I don’t aim for beauty in line—I aim for vitality, a pulse. For me, drawing is not subordinate to painting. It is painting, in its most distilled form.
CM
Motifs are constantly lost and found again, submerged and recovered. Just take Velázquez or Picasso … But while such ruptures are not hard to make, achieving the overall cohesion of the painting is far more difficult, I imagine.
SH
Indeed. It’s easy to break things apart. The challenge is to let them breathe again—to make the fractures coherent without erasing their tension. I try to keep the painting porous, unstable but whole. I want it to feel alive, not resolved.
CM
Curiously enough, you also categorize your stitched paintings—Foresta Negra, 2018, for instance—as »drawing«. How come?
SH
Because they emerge from the same logic. Stitching is another kind of line—one that cuts, joins and scars. It has rhythm, direction, fragility. In those works, the gesture is slower, more deliberate. But it’s still a gesture—a drawing with thread, with material memory. Inserted into the structure of the canvas, it becomes an unremovable construction.
CM
»Surfaces«, on the other hand, appear to be addressing the painterly process more immediately. As this group includes an abundance of as well as an almost complete void of colors. The paintings equally address the build-up of a dense painterly surface by means of overloading and sheer amassing as well as its dismantling by means of erasure and abrasion of painterly matter. Are such contrary states one and the same in your painting?
SH
They are inseparable. Accumulating and erasing are both acts of inscription. I see the surface as a terrain, an archive or accumulation of gestures. To cover is to protect, to remove is to reveal. The contrast between density and void is not a conflict—it’s a dialogue. Like the graphical line against the pictorial language: creating frictions, but being partners in the same dance. Painting is not a result—it’s a condition.
CM
How do you keep your so-called »Palette Paintings« like Untitled, 2017, or Untitled, 2021, which are comprised of immense masses of thick patches of pastose color, painterly under control?
SH
I don’t control them—I negotiate with them. In fact, I consider them my most processual and free-form works. These paintings come from the leftovers of other paintings and share that physicality. They accumulate like sediment. I intervene rhythmically, not compositionally. The painting tells me when it has reached a point of saturation, when it begins to articulate something beyond accumulation. It’s a form of listening.
CM
Do they have any kinship with Eugène Leroy, Frank Auerbach, Francis Bacon’s studio door, which he used as a larger than life palette, Georg Baselitz’ unique pile of sculpted colors (Sculpture, 1960) or Glenn Brown’s sculptural experiments?
SH
Certainly. I admire their radical materiality. They taught me that the residue of painting can itself become an image. But my relationship to them is intuitive, not theoretical. My Palette Paintings started from a studio habit—as a memory of a process, a sort of diary—from the floor to the scraping tools. Only later did I recognize their art historical echoes.
CM
Both in your »drawing« and your »surface« paintings there is a most tangible feel of fragility. The hand-drawn, scriptural lines tremble, the eradicated planes barely hold themselves together or are massively overburdened. The image itself is contested at all times and so are we beholders. There might be the famous quote by Philip Leider that »the thing in painting is color«, color and surface, but would you agree that there is more to your paintings than their mere materiality? Something that challenges all our lived experiences and frail composures.
SH
Absolutely. Materiality is the medium, not the message. What interests me is how painting can evoke fragility, doubt and presence. We are fragile! I want the image to breathe and tremble—to feel provisional, like a trace or a memory. The painting must remain open, vulnerable—as we are.
CM
»Form«, in turn, includes paintings with geometric shapes, almost like a Suprematist allusion, self-contained strokes or patches of color rhythmically shuffled and spread across the pictorial field, remnants of contours or figurative motifs. Even if these paintings share some characteristics with the 2 prior groups, what are their distinctive properties?
SH
They are attempts at order, but provisional. They speak to us of limits and impositions. In these works, the forms suggest logic, but resist hierarchy. They are derived from drawing, but aspire to structure. They are visual breaths—marks of silence between more turbulent states. Boundaries …
CM
And finally »figure«. You might generally be considered as an abstract painter, but your work has always been figurative, right from the start in the 1990s. Would you actually make a difference between figuration and abstraction in painting?
SH
I wouldn’t draw a strict line between figuration and abstraction. They are not opposites in my practice, but rather two modes of approaching the same enigma—the presence of the body in painting. The figure has always been there, sometimes clearly outlined, at other times dispersed, erased or veiled beneath the surface. Even in my most gestural or seemingly abstract works, there’s often a residue of anatomy, a trace of the human gesture. I’m not interested in depicting the body in a traditional sense, but in evoking its memory—how it vibrates through line, tension, density. Figuration, for me, is not an image—it’s a haunting. Something that persists, even when it’s no longer visible.
CM
Most of your paintings, materialize and fade at the same time, like spectres. Instead of being definitive, they have a trace-like quality. Do you care for such things?
SH
Yes, very much so! I want my paintings to endure, to question—not to assert or impose, but to suggest. For me, a good painting is like a half-memory: it stays with you, it changes, it demands something of you.
CM
And your paintings are open. They do not have a central motif nor a compositional support structure beneath. They rather expand from an empty center into an indefinite frontality. Visually, they float and drift, they radiate, vibrate and glisten. Quite a delicate challenge for any beholder, isn’t it?
SH
That openness is essential. I’m not offering a message, but an encounter. The paintings should receive the gaze, not direct it. I want to create a field of possibility—a space where uncertainty can be sustained. If it vibrates, if it feels alive, then it has done its work.
This openness is also a way of trusting the viewer. I don’t want to anchor the work in explanation, I want it to remain permeable. Painting, for me, is not an illustration of thought—it is thought in material form. It’s a site where meaning is negotiated, not imposed. That’s why I resist narrative closure. I prefer ambiguity over certainty, tension over resolution.
There’s also something about letting go—about allowing the painting to be what it wants to be. I’ve learned over time that control is only part of the process, the rest is attention, patience, doubt. Some of these ideas were reinforced early in my career by conversations with those who truly understand painting not as a static image, but as a living force. People who taught me that what matters most in a painting is not what it shows, but what it withholds—what it provokes, disorients or sustains in the viewer.
And perhaps that’s what sustains my practice, too: not the arrival at conclusions, but the willingness to stay in the unresolved. The trust that something essential might emerge precisely in or from that instability. That’s where painting lives—between presence and disappearance, between knowing and not-knowing. In the end, painting is the most silent, yet stubborn way I have found to speak about what can’t be said.
Secundino Hernández in conversation with Christian Malycha